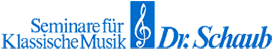Musikwissenschaftler Stefan Schaub über Geniestreiche der "Galeerenjahre" und das zukunftsweisende Spätwerk des Komponisten
"Badische Zeitung" vom 2.3.2007
Offenburg. Der Schlussapplaus hätte nicht größer sein können, wenn der Vortragende selber gesungen hätte! Am Montag sprach der Appenweierer Musikwissenschaftler Stefan Schaub auf Einladung der VHS Offenburg im rappelvollen Salmen über Giuseppe Verdi und dessen Opern — launig, klar, informativ, mit der für Schaub typischen Verbindung aus Begeisterung und Kenntnisreichtum, die so sehr animiert, dass man sofort ins nächste Opernhaus laufen möchte, falls dort nur gerade Verdi gegeben würde.
Da spielt Schaub uns knappe zwei Minuten aus der Wahnsinnsarie der Lady Macbeth vor — Verdi vertonte seine zehnte Oper "Macbeth" 1847 im Alter von 34 Jahren — in einer Aufnahme mit der Callas. Und plötzlich verstehen wir!
Zum Beispiel warum gerade diese Interpretation so einzigartig ist: Eben weil die Callas nicht "schön" singt, sondern leidenschaftlich, ja manisch! Verdi habe den Mut besessen, eine gefeierte Diva als Sängerin für diese Rolle abzulehnen, eben weil deren Gesang zu schön sei, erzählt Schaub. Ganz nebenbei weist er auf ein "Wegfließen des Tons", weil die Callas sich am Ende der Szene bei einem hohen Pianissimo wegdreht vom Mikrofon. Sie hat Blut gefordert, von ihrem Weichei-Gatten den nächsten Mord verlangt, somit ist alles gesagt, sie geht nun . . . Es ist eine Musik, die lodert. Nervöse Violinen, dunkel und zerrend die Klarinetten und Oboen, dazu die Stimme der Callas wie ein Rasiermesser. Schaub: "Da merken Sie an Ihrem Blutdruck, was da abgeht!"
Und Schaub belegt an weiteren Beispielen, darunter die Oper "Attila" , dass man in den ersten 15 Verdi-Opern der "Galeerenjahre" des Komponisten immer wieder grandiose Momente findet, wenn auch kaum eines dieser Werke durchgängig gut oder gar meisterhaft sei.
Der Ausdruck "Galeerenjahre" stamme vom Komponisten selbst. Verdi sei zwar seit Nabucco mit dem berühmten "Gefangenenchor" ein populärer, aber keineswegs ein unabhängiger Komponist gewesen. Es gab die Macht des Impressarios, der die Oper finanzierte, die Macht des Gesangsstars, der seine Bravourstücke wollte, und die Macht des Publikums, das die gewohnte Nummernabfolge zwischen schnell und langsam forderte. "Das Publikum will nur hören, was es kennt" , so Schaub zu diesem Punkt.
Der virtuose Musikwissenschaftler belegt mit einer geradezu parodistischen Arie aus Nabucco, wie unfreiwillig komisch diese Abfolge werden kann: Da dürstet es den Sänger rein textlich nach Blut, aber weil "abfolgetechnisch" jetzt "langsam" dran ist, walzert und schunkelt die Musik trotz Blutdurst höchst gemütlich!
Zum Einstieg präsentiert Schaub den Gefangenenchor: "Einstimmig komponiert und simpel, damit jeder mitsingen kann." Verdi habe gewusst, was er den patriotischen Italienern damit schenkt. Schaub verweist auf das simple "Schrumm-ta-ta" des Orchesters: "Nichts weiter als eine große Gitarre!" Und dann zeigt Schaub, wie Verdi nach acht Jahren bei "Rigoletto" aus der großen Gitarre einen fein differenzierten Klangkörper macht, wie die Arie der Gilda — gesunden von der Gruberova — mit Streicherfeinheiten, einer Flöte, gar mit vier Takten Chor zu einer berückenden Innigkeit jenseits des rauschenden Effekts findet. Und wie Verdi mit seinen letzten, späten Werken, die er 74-jährig und 80-jährig komponiert, Wagner mit Italien verbindet, Puccini den Weg weist, ohne die blühende, griffige Melodik aufzugeben.
Was das Hören mit Schaub zum Vergnügen macht, ist auch dessen sprachschöpferische Kraft: "Ein Verdi-Schlussakkord ist sozusagen stets der Kontrapunkt auf die zu erwartende Reaktion des Publikums." Er spielt uns als allerletztes Beispiel den Schluss von Falstaff vor — und beweist, dass er recht hat: Der Applaus rauscht auf und gibt dem finalen Orchester-Tutti die rechte Wirkung. Bravo!
Robert Ullmann